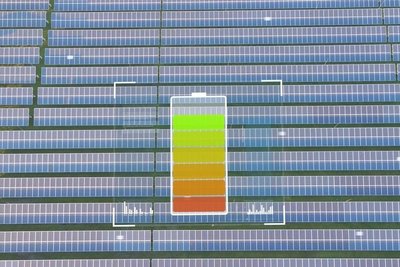Anlagentechnik Anlagentechnik

Stromspeicher Großanlagen sind ein wesentlicher Bestandteil des grundlegenden Wandels in der Stromversorgung. Die Energiewende bringt eine tiefgreifende Transformation mit sich: Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne liefern Strom nicht kontinuierlich, sondern abhängig von Wetterbedingungen und Tageszeit. Um dennoch eine stabile und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen, sind effektive Speicherlösungen erforderlich.
Großanlagen für die Stromspeicherung spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz zurückzuspeisen. Die eww Gruppe erkennt die Bedeutung moderner Speicherlösungen für eine stabile und klimafreundliche Energiezukunft und unterstützt diesen Wandel aktiv im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung durch vermehrte Investitionen in den Netzausbau.
Verschiedene Technologien stehen für die Stromspeicherung zur Verfügung, jeweils mit spezifischen Eigenschaften und Einsatzbereichen:
Stromspeicher erfüllen unterschiedliche Funktionen im Energiesystem:
Die Kapazitäten verschiedener Stromspeicher und ihre Eigenschaften sorgen für ideale Einsatzbereiche, die es zu nutzen gilt.
| Speicherart | Typischer Einsatzbereich | Speicherdauer | Hauptnutzen |
|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterie | Frequenzregelung, PV-Heimspeicher | Sekunden – Stunden | Netzstabilisierung |
| Redox-Flow-Batterie | Gewerbespeicher, Peak Shaving | Stunden – Tage | Lastverschiebung |
| Wasserstoff (PtG) | Langzeitenergieversorgung | Tage – Monate | Versorgung bei Dunkelflauten |
| Pumpspeicher-Kraftwerk | Tagesspeicher, Netzstützung | Stunden – Tage | Netzregelung, saisonale Pufferung |
| Druckluftspeicher (CAES) | Industrielle Großspeicher | Stunden – Tage | Zwischenspeicherung volatiler Strommengen |
Große Stromspeicher finden vielfältige Anwendungen:
Die Forschung konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Technologien und arbeitet am „Stromspeicher der Zukunft“:
In Österreich existieren bereits einige bedeutende Großspeicherprojekte, wie das Wasserstoffspeicherprojekt „Underground Sun Storage“ der RAG Austria AG oder das Batteriespeicherkraftwerk in Arnoldstein. Diese Anlagen demonstrieren das Potenzial von Großspeichern zur Netzstabilisierung und Energiespeicherung, haben aber derzeit noch Versuchscharakter.
Bei den international bereits häufig verwendeten Großbatteriespeichern fehlt in Österreich vorerst noch der vollständige rechtliche Rahmen. Das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) 2010 enthält keine eindeutige Definition oder spezifische Regelungen für Großspeicher. Dadurch entsteht Interpretationsspielraum hinsichtlich Zuständigkeiten, Genehmigungen und Marktrolle solcher Speicher.
Zwar gibt es Förderungen, z. B. durch den Klima- und Energiefonds, doch Planungs- und Genehmigungsverfahren sind oft komplex und langwierig. Besonders die erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen können mitunter viel Zeit kosten. Eine klarere gesetzliche Grundlage und einfachere Verfahren sind essenziell, um Investitionssicherheit zu schaffen und den Ausbau zu beschleunigen. Ein Entwurf für ein neues Elekrizitätswirtschaftsgesetz liegt vor, da aber für den Beschluss eine erhöhte Mehrheit im Parlament bedarf, ist es fraglich ob es in der entsprechend gebotenen Eile beschlossen wird.
Um Großspeicheranlagen effizient ausbauen zu können, sind neben stabilen gesetzlichen Rahmenbedingungen auch wirtschaftlich tragfähige Konzepte erforderlich.
Die Herausforderungen reichen von der Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Lithium und Kobalt über hohe Kosten bei Langzeitspeichern bis hin zu regulatorischen Unsicherheiten. Ein zentraler Aspekt für die erfolgreiche Integration von Großspeicheranlagen ist der Ausbau und die Ertüchtigung der Stromnetze. Nur durch leistungsfähige, intelligente Infrastrukturen lassen sich Speicherkapazitäten effizient in das Energiesystem einbinden. Genau aus diesem Grund investiert die eww Gruppe in den kommenden fünf Jahren rund 60 Millionen Euro in den Ausbau ihrer Netzinfrastruktur – ein wesentlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Umsetzung der Energiewende.